Angaben gemäß §5 TMG: arq decisions GmbH | Nobistor 16 | 22767 Hamburg
Vertreter und redaktionell verantwortlich: Dr. N. Wallmeier HRB 183688 | UStID DE364637464
Streitbeilegungsverfahren vor der Universalschlichtungs-Stelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein.
Für eine Kultur der Antizipation. Innovation auf solider Grundlage, made in Hamburg.
Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Bürozeiten: Montag - Freitag von 9 bis 17 Uhr.

L&D Strategie
arq enterprise
26 Jan. 2025
Pünktlich zum Fest ist mein Artikel „Mit guten Fragen zu besseren Entscheidungen“ auf hrm.de (link) veröffentlich. Darin betone ich die Bedeutung von HR für die Entwicklung von Urteilsvermögen und präzisen Fragestellungen. Damit werden Entscheidungen im Unternehmen fundierter und der Zufall als Ergebniskomponente zurückgedrängt. Es folgt eine Zusammenfassung des Artikels und im Anschluss weitere Beispiele der Simpsons. Die sollen aufzeigen, dass sich eine Investition für den Blick in die Zukunft durchaus lohnt. Der Knackpunkt für bessere Entscheidungen ist die Kristallkugel in unseren Köpfen Der erste Punkt ist die Erkenntnis, dass wir alle eine „Kristallkugel im Kopf“ haben. Die ermöglicht uns, verschiedene Zukunftsszenarien durchzudenken. Diese Kristallkugel sorgt auch dafür, dass unsere Erinnerungen nicht so sicher sind wie beispielsweise die Anzeige unseres Kontostands. Daher benutzen wir Werkzeuge wie Schrift, Kalender und andere, um Verhalten und Einsichten sicher für die Zukunft nachzuhalten und festzuschreiben. Schärfen wir also unseren Blick nach vorne, schärfen wir gleichzeitig unseren Blick in die Vergangenheit. Die Kernpunkte des Artikels: Gute Entscheidungen basieren nicht auf Glück, sondern auf gesundem Menschenverstand: und gutes Urteilsvermögen ist erlernbar . Die Qualität von Entscheidungen sollte nicht allein am Ergebnis gemessen werden. Der Zufall sorgt sowohl für glückliche wie unglückliche Ausgänge. Daher habe ich vier einfache Maßnahmen aufgeführt, die der Verbesserung des Urteilsvermögens dienen: Umgang mit Unsicherheit lernen Bias erkennen und reduzieren Feedback und Reflexion nutzen Perspektivenvielfalt einbinden Der nächste Schritt für eine Organisation ist die gewinnbringende Ausbildung der Fähigkeit . Dann können sie von kollektiver Intelligenz und geeigneten Strukturen zur Bewältigung von Unsicherheiten profitieren. Die guten Fragen der Simpsons animieren uns zum Spiel mit deren Eintritt Um die Kristallkugel und unser Verhalten mit Prognosen zu erläutern, habe ich eine Analyse eingetretener Prognosen der Simpsons vorgestellt. Die Simpsons-Serie hat mehrere bemerkenswerte Vorhersagen getroffen, die später Realität wurden: Musikalische Kollaboration: Die Serie zeigte die Hip-Hop-Band Cypress Hill mit dem London Symphony Orchestra 30 Jahre vor dem tatsächlichen Auftritt im Jahr 2024. Hier ist eine kausale Erläuterung einfach. Die Folge hat beide zu einem gemeinsamen Auftritt inspiriert. Tigerattacke: Eine Folge zeigte einen weißen Tiger, der Roy angreift, was später tatsächlich geschah. Tiger verstehen Fernsehen nicht. Dennoch ist die Folge ein gutes Beispiel für eine neue Perspektive. Nicht nur war der Angriff ein finanzielles Debakel für das Hotel, mit der richtigen Frage nach einer schweren Verletzung bei tausenden Stunden mit Tigern in einem Käfig ist sie auch gar nicht so abwegig. Politische Vorhersagen: Die Serie „sagte“ Donald Trumps Präsidentschaft voraus, sowie ein Attentat auf ihn und Lisa Simpson als Nachfolgerin mit Perlenkette. Die Medien haben das Bild sowohl zur Wahl von Joe Biden als auch für eine mögliche Wahl von Kamala Harris gerne zitiert. Die Folge zeigt, dass mit Prognosen gerne kokettiert wird und das ein nah dran oft ausreichend ist. Nun ist Trump zurück und in vier Jahren gibt es eine neue Chance. Zusammengefasst werfen diese Vorhersagen interessante Fragen auf: Haben die Simpsons-Schöpfer tatsächlich Entwicklungen vorhergesehen, oder haben ihre Ideen die Realität beeinflusst? Wie viele der „Vorhersagen“ sind auf Zufall zurückzuführen? Welche Rolle spielt die kreative Vorstellungskraft bei der Antizipation zukünftiger Ereignisse? Es ist wichtig zu beachten, dass viele dieser „Vorhersagen“ auf scharfsinniger Beobachtung aktueller Trends und kreativer Spekulation basieren, wie der Showrunner Matt Selman selbst erklärt hat. Dies unterstreicht die Bedeutung von Vorstellungskraft und kritischem Denken – die Bedeutung der Kristallkugel – bei der Entscheidungsfindung und Zukunftsplanung. Und solche Prognosen sind im Geschäftsalltag gang und gäbe. Wäre es nicht gut die Eintrittswahrscheinlichkeit der relevantesten Prognosen zu verfolgen? Weitere Beispiele aus 800 Folgen Simpsons Hier sind weitere bemerkenswerte Vorhersagen der Simpsons, die sich bewahrheitet haben. Welche Prognose würden Sie gerne in einer Folge sehen? NSA-Überwachungsskandal: In „Der Film“ aus dem Jahr 2007 enthüllte die NSA eine massive Überwachungsoperation, ähnlich den Enthüllungen von Edward Snowden im Jahr 2013 Legalisierung von Cannabis in Kanada: Eine Episode aus dem Jahr 2005 zeigte Ned Flanders, der legal Marihuana in Kanada kauft. Dies wurde 2018 Realität Nobelpreisträger: 2010 sagte die Serie voraus, dass Bengt Holmström den Nobelpreis gewinnen würde, was 2016 tatsächlich geschah Pferdefleisch-Skandal: Eine Episode von 1994 deutete auf Pferdefleisch in Schulkantinen hin, was 2013 in Europa tatsächlich aufgedeckt wurde Wahlmaschinen-Manipulation: 2008 zeigte eine Folge manipulierte Wahlmaschinen, was bei den US-Wahlen 2012 tatsächlich vorkam USA gewinnt Gold im Curling: Die Serie sagte 2010 voraus, dass die USA im Curling Gold gewinnen würde, was bei den Olympischen Winterspielen 2018 eintraf Lady Gaga beim Super Bowl: Eine Episode aus 2012 zeigte Lady Gaga bei einer Super Bowl-Halbzeitshow, was 2017 Realität wurde Dreiäugiger Fisch: 1990 wurde ein dreiäugiger Fisch in der Nähe eines Kernkraftwerks gezeigt. 2011 wurde tatsächlich ein solcher Fisch in Argentinien gefunden Voraussage der US-Wahlkarte 2024: Eine Folge zeigte eine Wahlkarte, die der tatsächlichen Karte der US-Wahlen 2024 sehr ähnlich war Kamala Harris‘ Outfit: Lisa Simpson trug als Präsidentin einen ähnlichen lila Anzug und Perlenkette wie Kamala Harris bei ihrer Amtseinführung als Vizepräsidentin
L&D Strategie
arq enterprise
18 Okt. 2024
Eine provokante Diskussion beim Founders Fight Club auf der Zukunft Personal 2024 in Köln. Zum Thema „Zukunftsorientierte Entscheidungsfindung: Engagement und Skills durch innovatives Lernen“ hat arq decisions Gründer Dr. Niklas Wallmeier seine Sichten auf die Skillment-Themen der Zukunft in den Kampf geschickt. Host: Die kontinuierliche Fähigkeitenentwicklung führt zu einer Überqualifizierung der Mitarbeiter, was die Karriereentwicklung behindert, und die Fluktuation erhöht. Wallmeier: Was ist, wenn wir sie entwickeln, und sie gehen. Ich frage, was ist, wenn ihr sie nicht entwickelt und sie bleiben? Kann es eine Antwort sein, ausschließlich mit der Qualifizierung, die wir heute im Griff haben, morgen Probleme lösen zu wollen? Die Frage muss eher sein, wo setze ich meine Schwerpunkte. Was sind Fähigkeiten, die uns strukturell weiterbringen, mit denen man auch eine Kultur prägen kann. Eben nicht nur die Fähigkeiten, die man sofort greifen kann. Host: Unternehmen, die auf innovative Lernmethoden setzen, schüren unrealistische Erwartungen an Mitarbeiter und überfordern sie letztlich. Wallmeier: Das ist möglich. Gilt aber auf keinen Fall absolut. Innovativ bedeutet schließlich nicht Lösung, sondern neu dort, wo Raum für einen neuen Lösungsversuch war. Man muss allerdings klären, was die strategischen Ziele sind: was sollen die Mitarbeiter erreichen, wie viel Zeit ist dafür notwendig, und wie viel Zeit sind wir bereit zu investieren, ggf. auch mit zweiten und dritten Anläufen. Lernen geht leider nur über Fehler. Und die muss man einplanen und aushalten können. Host: Strategisches Upskilling ist eine Verschwendung von Ressourcen – wer keine Entscheidungskompetenzen hat, wird sie auch durch modernes Lernen nicht entwickeln. Wallmeier: Riesen-Widerspruch. Nicht jeder muss alles können. Gerade Entscheidungskompetenz, in erster Linie Einschätzungskompetenz lässt sich hervorragend trainieren und entwickeln. Aber da sind wir wieder bei Innovation. Da muss man sich auf neue Wege wagen. Offensichtlich sind die bisherigen Ansätze nicht so erfolgreich. Und gerade bei diesem Lieblingsthema, Entscheidun<sgskompetenz, erleben wir seit 20 Jahren Revolutionen in der Forschung. Das „Wie“ ist hier also die Frage. Also wie versuchen wir Entscheidungskompetenz zu vermitteln. Host: Wie können Unternehmen sicherstellen, dass neue Lernansätze nicht nur kurzfristig das Engagement steigern, sondern auch langfristig in die Unternehmenskultur integriert werden? Wallmeier: Der Lernansatz ist dabei nicht so entscheidend wie der Inhalt. Schafft man den Leuten etwas drauf, was gezielt abrufen müssen, wird es schwierig, weil die Kapazitäten begrenzt sind. Investiert man in einen Meta-Skill, den der Mitarbeiter nicht abrufen muss, sondern der seine Intuition verändert, hat man auch gute Chancen eine Kultur zu prägen. Host: Welche innovativen Lernmethoden fördern besonders die kritische Denkfähigkeit und Problemlösungsstrategien, die für zukunftsorientierte Entscheidungen notwendig sind? Wallmeier: Ich will das einfach halten. Entscheidungen haben für mich einen klaren Kern. Kenne ich die Konsequenzen meiner Entscheidung mit Sicherheit, ist meine Entscheidung trivial. In einer solchen Welt leben wir nicht, sondern in einer unsicheren. Das heißt wir müssen lernen, unsichere Dinge so gut es geht einzuschätzen, um die Unsicherheit so weit es geht zu reduzieren. Menschen hassen das, jeder versucht sich eine übersichtliche kontrollierbare Welt zu bauen. Die gute Nachricht ist, lassen sich Menschen darauf ein mit Unsicherheit umzugehen, werden sie schnell und nachhaltig besser darin. Also ganz klare Empfehlung: Fokus auf Einschätzungskompetenz, daraus folgt Entscheidungskompetenz. Host: Wie können Unternehmen den Erfolg von spielbasierten Lernprogrammen und Upskilling-Initiativen messen, insbesondere im Hinblick auf verbesserte Entscheidungsfindung? Wallmeier: Da kann ich nur anknüpfen: Die Entscheidung an sich ist nicht messbar. Was eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, ist zum hohen Grad subjektiv. Die Entscheidungsgrundlage ist aber messbar. Wie gut schätzen die Leute die Szenarien ein? Hier sind sowohl individuelle Entwicklung als Vergleiche bestens messbar. Host: Wie beeinflusst die Förderung einer Lernkultur das Engagement der Mitarbeiter und ihre Bereitschaft, sich aktiv an strategischen Entscheidungen zu beteiligen? Wallmeier: Das würde ich auch gerne wissen. Ich bin hier, um mehr darüber zu erfahren, wie sehr Unternehmen dieses anstreben. Meine Annahme ist, dass dort ein enorm großer Hebel liegt. Die Frage ist für mich, wie spürbar ist die Beteiligung? Schafft man es die Beteiligung mit den Stärken eines Mitarbeiters zu verknüpfen, gerade, wenn man diese über Skill-Entwicklung identifiziert hat? Es wird wichtig sein, nachzuvollziehen, wie man beteiligt wird. Beteiligung und Wertschätzung gehen da vermutlich am besten Hand in Hand. Host: In welchen Branchen hat spielbasiertes Lernen besonders großen Einfluss auf die Fähigkeitenentwicklung, und warum sind diese Methoden dort besonders effektiv? Wallmeier: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es generelle Unterschiede gibt. Ich halte das mehr für eine Frage, ob man schon den richtigen match gefunden hat. Das richtige Spiel für Branche, Rolle, und Fähigkeit zu finden, ist sicher keine triviale Aufgabe. Ich bin aber sicher, für jede Anforderung gibt es die Lösung. Überall muss gelernt werden, es in Spielen zu verpacken hilft. Ich lasse mich aber gerne von Praxiserfahrung korrigieren. Host: Welche Rolle spielen neue Technologien, wie KI und virtuelle Realität, bei der Gestaltung innovativer Lernansätze zur Verbesserung der Entscheidungsfindung? Wallmeier: KI ist für mich in erster Line ein Inhalt bei Verbesserung von Entscheidungsfindung. KI wird nicht eingeführt, sondern ist schon lägst da. Das Potenzial davon zu nutzen, beginnt nicht erst beim aktiven Umgang mit einer KI, wie etwa dem Prompten, sondern bei der Einschätzung der von der KI bereitgestellten Informationen. Wie gewinnt man Vertrauen im Umgang mit den Informationen? Dafür ist KI-literacy wichtig. Beispielweise laterales Lesen, wie erkenne ich, was Murks ist, und was echt ist. Das ist sehr verwandt, was wir mit Medienkompetenz und Fake news schon lange auf dem Teller haben, aber gerne vor uns herschieben.
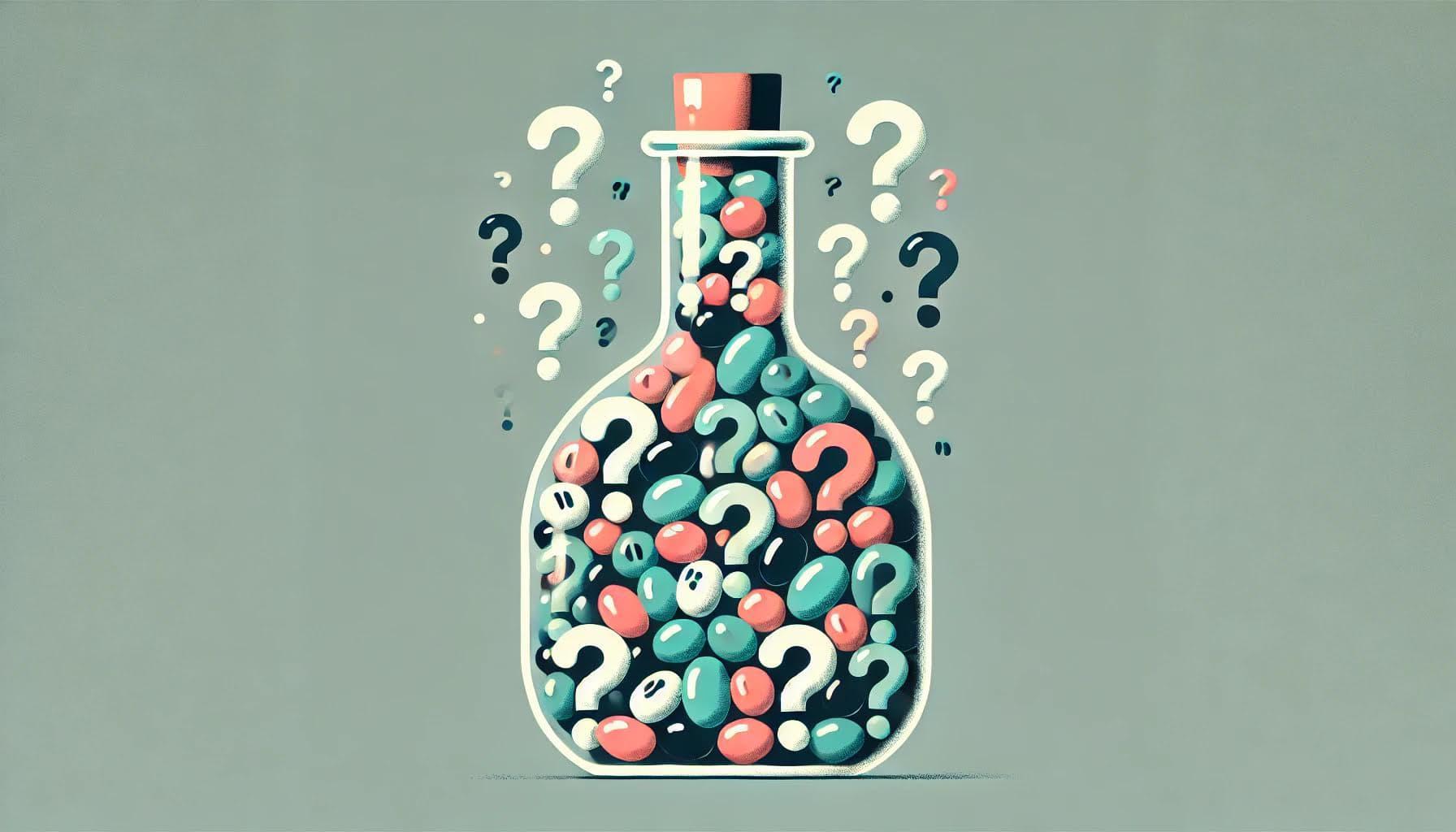
arq enterprise
29 Sept. 2024
Wie viele Jelly Beans… Die Fragen sollen zum nachdenken über Dein Urteilsvermögen anregen. Zuerst geht es um Deine beste Schätzung: wie viele Bohnen sind im Glas? Und dann – Überraschung, geht es um Deine sichere Einschätzung: wie viele Bohnen sind auf jeden Fall im Glas? Wenn das für Dich ein und dieselbe Frage ist, hilft Dir unser Kalibrierungstrainer. Du erhältst nach der Veranstaltung kostenfreien Zugriff, sofern unten der Kontakthaken gesetzt ist. Ohne Haken nimmst Du mit der Schätzung am Tippspiel teil. Der jeweils beste Tipp gewinnt das Buch „Sichere Prognosen in unsicheren Zeiten“ von Superforecaster Bruno Jahn. Gewinnspiel und Ergebnisse Ihr erhaltet nach absenden der Einschätzung unser eBook über „die Natur guter Entscheidungen“. Im Anschluss an die Veranstaltung kommen die Ergebnisse des Experiments und die Auflösung der Fragen. Die Gewinner der Verlosung werden separat benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das war’s ohne Haken. Mit Haken unter Deiner eMail halten wir in unregelmäßigen Abständen (größer als einem Monat) Kontakt mit Dir. Du erhältst weiter kostenfrei Zugriff auf unseren digitalen Kalibrierungstrainer. Mit einem Follow auf LinkedIn hilfst Du uns, über das Thema zu informieren. Danke Dir!
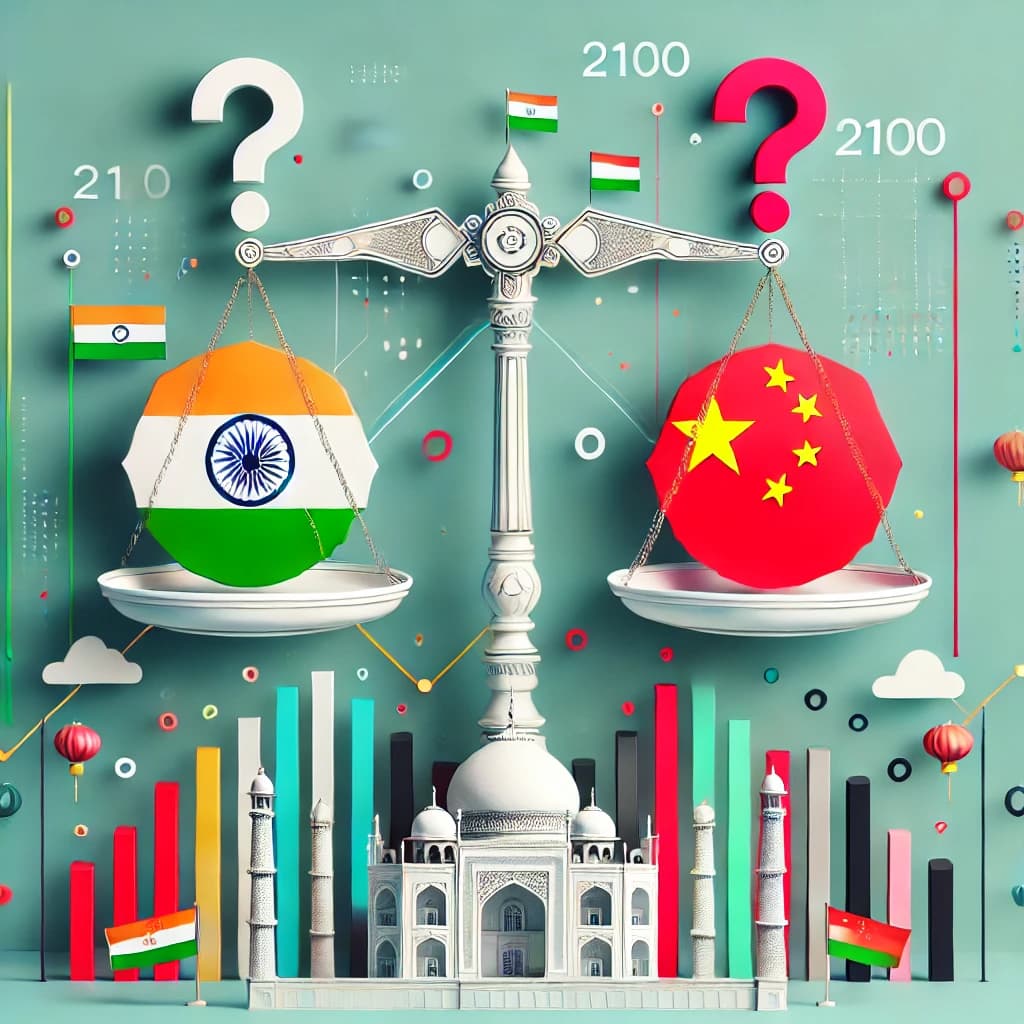
L&D Strategie
arq enterprise
22 Sept. 2024
Timo Wienefoet diskutiert mit dem Superforecaster und Autor Bruno Jahn über die Frage, ob Indien im Jahr 2100 China als größte Wirtschaftsmacht überholt. Die Frage ruft vermeintlich nach fortgeschrittenem Urteilsvermögen. Und doch kann sie einfacher und umfassender als vielleicht angenommen aktuelle Unternehmensentscheidungen informieren. Superforecaster sind die besten Prognostiker aus einem Projekt der amerikanischen Sicherheitsdienste, indem hunderte geopolitischer Zukunftsfragen zu beantworten waren. Bruno Jahn hat seine Erfahrungen über dieses Projekt in dem Buch „Sichere Prognosen in unsicheren Zeiten“ (Link zum Buch auf Amazon) festgehalten. Wenn ich jetzt gefragt werde, würde ich sagen: Ja, im 21 Jahrhundert wird Indien China als die größte Volkswirtschaft der Welt nach Kaufkraftparität überholen.“ Bruno Jahn, Superforecaster Für mich ist die Frage, ob Indien China in 75 Jahren als größte Wirtschaftsmacht ablöst, eine sehr gelungene. Gerade die Langfristigkeit verspricht kurz- und mittelfristig wichtige Perspektiven für Entscheidungen mit ähnlich langem Zeithorizont.“ Timo Wienefoet, Geschäftsführer arq decisions GmbH Fragen wie diese fördern, besonders als Vergleich formuliert, die Kommunikation an der Schnittstelle zwischen Strategie und operativer Umsetzung. Trends lassen sich darunter einordnen, mit Signalen versehen und so als Früh-Indikatoren dienen, bevor Schlüsse aus den eigenen Daten gezogen werden können. Die Langfristigkeit schafft ergebnisneutrale Perspektiven für anstehende Entscheidungen mit ähnlich langem Zeithorizont. Im Rahmen von Investitionsentscheidungen werden diese Fragen heute vielfach gestellt. Mit einer strukturierten Ableitung und Einschätzung kurz- und mittelfristiger Fragen ergeben sich diese neuen Perspektiven auf die Zukunft. Das Verständnis langfristiger Entwicklungen hilft Ressourcen effektiver zuzuteilen und Investitionen mit der Zukunft in Einklang zu bringen. Es sorgt dafür in Gänze besser auf Veränderungen vorbereitet zu sein, Entscheidungen fundierter zu treffen und Risiken und Chancen effektiver zu managen. Mit unserer Plattform enterprise perspectives lassen sich Superforecaster einbinden. Dazu entwickelt die Lösung das Talent zu guten Einschätzungen in der Belegschaft und bindet diese Schwarmintelligenz ein. Denn ob Superforecaster oder nicht, gute Prognosen werden durch Teamwork und Training besser.
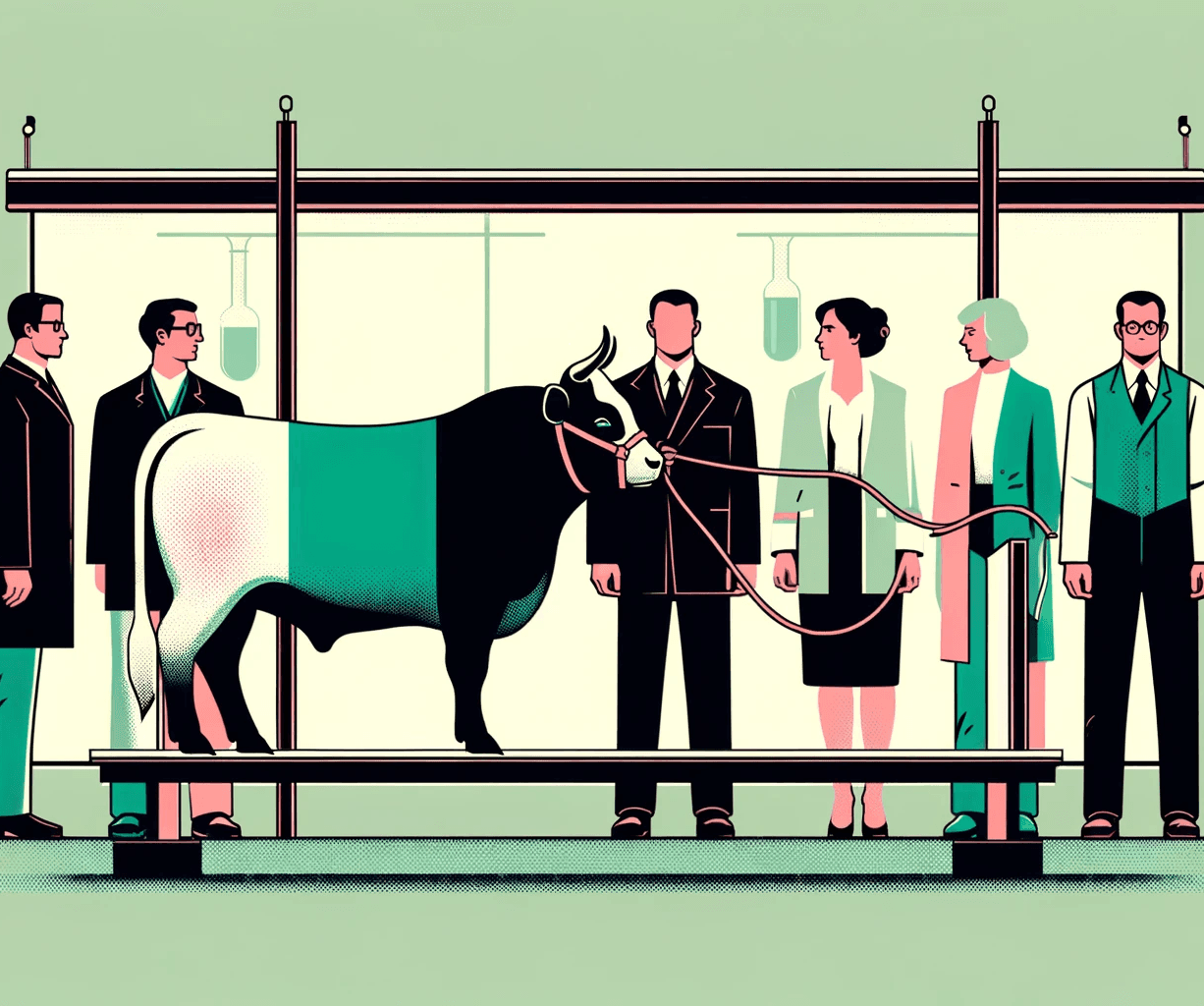
arq enterprise
22 Mai 2024
Die Entscheidungen von heute bestimmen den Erfolg von morgen. Jeder bringt den Schlüssel zu besseren Entscheidungen mit. Wir zeigen sechs Etappen, die Sicht auf eine Entscheidung zu ändern und das verborgene Potenzial zu aktivieren. Auf der ersten Etappe zum guten Entscheiden beginnen wir die Entscheidung und das Ergebnis getrennt voneinander zu bewerten, denn: Eine gute Entscheidung bedeutet noch kein gutes Ergebnis. Ein gutes Ergebnis aber auch keine gute Entscheidung. Für ein gutes Ergebnis braucht man zwei Dinge: eine gute Entscheidung und Glück. Für diese Behauptung bekommt man wenig Widerspruch. So sehr es die Menschen in der Voraussicht zu bedenken scheinen, so sehr löst es sich in Luft auf, wenn das Ergebnis da ist. Dann heißt es: Gutes Ergebnis = Gute Entscheidung. Schlechtes Ergebnis = Schlechte Entscheidung. Die Pokerspielerin nennt es Resulting: Die Entscheidung wird allein aus Sicht des Resultats bewertet, anstatt aus Sicht der Annahmen und Einschätzungen, die der Entscheidung zu Grunde lagen. Wir wissen, dass wir nur lernen können, wenn wir uns anschauen, wenn wir nachhalten, was wir tun. Übersehen wir den Faktor Glück, verpassen wir es, unsere Einschätzungen zu überprüfen und anzupassen (oder nicht voreilig über Bord zu werfen), um langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen. Haben wir unsere Einschätzungen klar im Blick, können wir auf der zweiten Etappe beginnen, aus ihnen zu lernen und unser Einschätzungsvermögen zu trainieren. Das richtige Niveau ist die Herausforderung. Ist das Ziel zu hochgesteckt, wird man sich ihm nicht nähern, aber: Mit einer Einschätzung danebenliegen zu können ist zwar unangenehm, aber notwendig, um sie zu schärfen. Overconfidence. Das haben Sie schonmal gehört. Wenn man seine eigenen Fähigkeiten überschätzt und höher zielt, als man springen kann. In Konsequenz liegt man zu oft, zu weit daneben. Eine natürliche Reaktion, um dieses Versagen zu vermeiden, ist (übertriebene) Vorsicht. Wir planen genug Luft ein, damit wir unsere Zielregion auf keinen Fall verfehlen. Nie falsch zu liegen, das klingt verlockend. Es bringt aber zwei enorme Nachteile, underconfident zu sein. Ist die Spanne für das Ziel enorm groß, ist diese zwar verlässlich, aber überhaupt nicht präzise. Das bedeutet, mit einer solchen Einschätzung kann man wenig anfangen, zumindest viel weniger als möglich wäre. Darüber hinaus verpassen Sie es Ihre Einschätzungen zu trainieren. Für eine sehr vorsichtige Einschätzung bedarf es weniger Annahmen. Folglich entsteht auch wenig Gelegenheit über das eigene Einschätzungsvermögen zu lernen. Ziel unserer Einschätzungen muss es sein, nicht nur hinreichend verlässlich, sondern auch möglichst präzise zu sein. Die richtige Balance ist die Herausforderung. Mit der geschärften Einschätzung treten wir auf die dritte Etappe unseren Gewohnheiten entgegentreten. Es gilt das bessere Einschätzungsvermögen auch in bessere Entscheidungen umzusetzen. In der Psychologie ist eine Vielzahl von Verzerrungen in der Wahrnehmung oder im Verhalten erforscht, die uns von besseren Entscheidungen abhalten, also: Vertrauen Sie Ihrem Einschätzungsvermögen und entscheiden Sie anders als bisher. Die Gemeinsamkeit der meisten Verzerrungen ist, dass sie uns Sicherheit in unserer bisherigen Sicht auf die Welt geben – egal ob richtig oder falsch. Das befriedigt das Kontrollbedürfnis und vermeidet das unangenehme Gefühl, falsch gelegen zu haben. Die gute Nachricht ist, dass Sie die meisten Verzerrungen schon auf den ersten beiden Etappen ins Visier nehmen. Stellvertretend und für die Verzerrungen, die uns davon abhalten, besser zu entscheiden, dreht sich diese Etappe um den Status quo bias. „Das haben wir immer schon so gemacht.“ Dabei denken Sie vielleicht noch mit: „Und das wird auch seinen Grund haben.“ Mindestens aber ist es unangenehm seine Entscheidung zu ändern. Denn das bedeutet schließlich, dass sie bisher falsch war. Nehmen Sie hier die Außenperspektive ein: Würden Sie jemanden anderem raten, die Entscheidung zu ändern, auch wenn dadurch klar werden würde, dass die Entscheidung bisher falsch war? Der Blick nach vorne ist der, der zählt. Der Blick zurück ist nur spannend, um seine Einschätzungen zu überprüfen und sie zu verbessern. Dabei stellt sich häufig heraus, dass die Entscheidung gar nicht falsch war. Bis zum Zeitpunkt, wo Sie sie aufgrund von neuen Informationen geändert haben, war sie wohlmöglich die beste Entscheidung, die Sie treffen konnten. Wenn Sie vor einer Veränderung stehen und neue Informationen haben, eine neue Einschätzung treffen, fragen Sie sich: Wenn es schon anders wäre, würde ich auf den Status quo wechseln? Sie haben auf den ersten Etappen gelernt, Ihr Einschätzungsvermögen zu schärfen und ihm bei Entscheidungen zu vertrauen. Ihre Einschätzungen können nur so gut sein, wie sie neue Informationen verarbeiten. Neue Informationen kommen in Massen und nicht alle sind relevant für Ihre Einschätzung. Wenn Sie eine Einschätzung treffen, fragen Sie sich also: Wie war es bisher und warum ändert eine neue Information meine Einschätzung, dass es anders sein wird? Nicht aus Prinzip beim Status quo zu verharren, die Annahmen hinterfragen, die Einschätzungen anpassen: Das sind Grundpfeiler einer guten Entscheidung. Wie bei den Etappen zuvor, sind auch auf der vierten Etappe Nuancen gefragt. Jede Information ist ein Signal, aber nicht jedes Signal ist stark genug, um die Entscheidung zu ändern. „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.“ Die Herausforderung ist immer, den Blick auf das Ganze zu behalten, und seine Einschätzung nicht zu stark von Einzelfällen beeinflussen zu lassen. Beispielhaft für unsere Schwierigkeiten, neue Informationen richtig einzuordnen, ist der nachlässige Umgang mit der Grundgesamtheit, der base rate fallacy. Diese dreht sich im Kern um scheinbar einfache Analogien, wie jeder Hund ist ein Tier, aber nicht jedes Tier ist ein Hund. Diese verstehen wir in der Regel schnell und gut. Informationen im Alltag sind aber häufig komplexer und wir verlieren schnell den Überblick. Denken Sie an einen DNA-Test, mit dem Sie eine Person finden wollen. Ist dieser positiv, ist er mit sehr großer Wahrscheinlichkeit korrekt. Es gibt aber auch falsch-positive Testergebnisse. Das heißt, jeder mit der gesuchten DNA hat einen positiven Test, aber nicht jeder mit positivem Test hat die DNA. Haben Sie nur zwei Personen vor sich, ist ein positiver Test, ein deutliches Signal. Haben Sie 1.000.000 Personen getestet, spricht die Grundgesamtheit dafür, dass der positive Test eher nicht zu der gesuchten Person gehört. In der Menge der Informationen den Überblick zu behalten, die Signale vom Rauschen zu trennen, ist der Schlüssel, um sich eine gute Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Die Informationen liegen uns in der Realität leider nicht geordnet und in ihrer Gesamtheit vor. Die fünfte Etappe stellt deswegen die Frage an die Herkunft unserer Informationen. Sie müssen einschätzen können, ob Sie sich auf die Informationen verlassen können. Deswegen: Hinterfragen Sie durch welchen Filter Ihre Informationen gelaufen sind. Daten können alle möglichen Geschichten erzählen. Nicht alle Geschichten können gleichzeitig stimmen. Für irreführende Geschichten muss aber keine schlechte Absicht vorliegen, denn wenn die Grundgesamtheit gefiltert ist, tauchen Scheinzusammenhänge auf. Vielleicht kennen Sie das berühmte Bild: Der Umriss eines Flugzeugs und rote Punkte, die die Einschussstellen beim Kampfeinsatz markieren. Hier wollte die Armee Verstärkung anbringen, um die Flugzeuge vor Abschüssen zu schützen. Sie hatten allerdings nicht alle Daten, sprich alle Flugzeuge zur Verfügung. Eben nicht die, die abgeschossen wurden. Diese Anekdote prägte den Begriff Survivorship bias, eine spezielle Variante des selection bias. Wann immer Sie Informationen vorliegen haben, fragen Sie, ob diese die Grundgesamtheit repräsentieren, die Sie für Ihre Entscheidung brauchen. Erfolgreiche Aktienfonds, oder hohe Weiterempfehlungsraten von Kunden sind keine Stichproben, sondern das, was nach einem Filter von der Grundgesamtheit übrigbleibt. Die unterdurchschnittlichen Aktienfonds verschwinden vom Markt, die unzufriedenen Konsumenten werden keine Kunden. Holen Sie das meiste aus Ihren Informationen heraus, indem Sie sich die Filter bewusst machen. Auch die letzte Etappe dreht sich um den Umgang mit Informationen. Mit geschärftem Einschätzungsvermögen und klaren Blick auf die Informationen bleibt noch das, was nur Sie leisten können und Ihnen keine KI abnehmen wird. Die Kunst die richtige Frage zu stellen: Welche Geschichte ist die richtige? Auch mit vollständigen Informationen erzählen die Daten viele Geschichten gleichzeitig. Und die können alle wahr sein. Ihre Aufgabe ist die richtige Geschichte für Ihre Entscheidung zu finden. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine bessere Anstellungsquote für Bewerberinnen erreichen. Immer noch sind Männer bei den Bewerbungen im Schnitt erfolgreicher als Frauen. Sie holen Zahlen ein, welche Abteilung am meisten in der Bringschuld ist. Alle Abteilungen berichten, dass sie höhere Quoten für Frauen, als für Männer vorweisen können. Wie kann das denn sein? Abteilung A Abteilung B Männer 20/100=20% 34/400=8,5% 54/500=10,8% Frauen 11/50=22% 95/950=10% 106/1000=10,6% In den Abteilungen, wo es schwieriger ist, eine Anstellung zu bekommen, bewerben sich viel mehr Frauen, und umgekehrt. So fallen die schwierigen Bewerbungen für Frauen viel stärker ins Gewicht. Die Abteilungen sind ein confounder und beeinflussen den Zusammenhang von Geschlecht und Erfolgsquote. Kategorien verändern die Aussage derselben Daten. Die wichtige Frage ist, zählen die einzelnen Abteilungen oder große Ganze? Für eine gute Entscheidung kommt es auf Ihren Blick, und Ihre Wertung an, was die richtige Geschichte ist. Wir begleiten Sie bei den Etappen mit den Produkten und der digitalen Plattform von arq decisions. Nutzen Sie die Fußball-Europameisterschaft und trainieren Sie Ihr Einschätzungsvermögen bei unserem Tippspiel der besonderen Art. Sammeln Sie Punkte, indem Sie bei unseren Fragen früher, weniger falsch liegen. Ein ehrliches „Ich weiß es nicht“, ist bei uns mehr wert als zu raten. Wir verlosen unter allen Teilnehmenden exklusive Workshops zur guten Entscheidung. Die Sieger dürfen die Empfängerorganisation für den Spendenpool auswählen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
